 Bildrechte: Niedersächsische Staatskanzlei
Bildrechte: Niedersächsische Staatskanzlei
‚Einfacher, schneller günstiger‘ – ein Blick in die Werkstatt und auf bereits Erreichtes
Mit dem Ziel ‚Einfacher, schneller, günstiger‘ beschreitet Niedersachsen aktuell zwei, einander ergänzende Wege: die Umsetzung des Bund-Länder-Paktes für Planungs- Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung sowie landeseigene Vereinfachungs- und Beschleunigungsmaßnahmen.
Über den aktuellen Stand der Umsetzung des Bund-Länder-Paktes in Niedersachsen und über die weiteren hier im Land bereits in Gang gesetzten beziehungsweise geplanten Verfahrensvereinfachungen informieren Ministerpräsident Stephan Weil, Kultusministerin Julia Willie Hamburg, Umweltminister Christian Meyer und Wirtschaftsminister Olaf Lies.
Weniger Bürokratie und höhere Geschwindigkeit für mehr wirtschaftliches Wachstum, so lauten die Ziele des ‚Paktes für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung‘, den der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder am 6. November 2023 geschlossen haben.
Dieser Pakt enthält konkrete Arbeitsaufträge, um Gesetze, Verordnungen und sonstige Regelungen zu ändern und Deutschland schneller zu machen. Es geht um über 100 Einzelregelungen, die es einfacher machen, Mobilfunkmasten zu errichten, Erneuerbare Energien auszubauen sowie Straßen, Schienen, Brücken und Stromnetze zu sanieren oder zu ersetzen.
Die klare Zielsetzung: Planungs- und Genehmigungsverfahren dürfen nicht mehr so lange dauern, Energie- und Infrastrukturprojekte sollen schneller und unkomplizierter und damit auch kostengünstiger realisiert werden. Der Wirtschaftsstandort Deutschland soll wettbewerbsfähig bleiben, die Digitalisierung soll vorangehen, der Umbau des Energiesystems zeitnah gelingen, Klimaziele sollen erreicht werden.
Nun zeigt ein erster Monitoring-Bericht, dass Bund und Länder gut vorankommen. Etwa ein Drittel der Aufträge aus dem Beschleunigungspakt sind bereits vollständig umgesetzt, mit etwa der Hälfte wurde begonnen. Von den vorgesehenen Maßnahmen können die Länder bei 63 – ohne Bundbeteiligung – aktiv werden.
Niedersachsen hat von diesen 63 Maßnahmen (Stand: 06/2024) bereits 28 (44 Prozent) umgesetzt, und weitere 30 (48 Prozent) begonnen. Insgesamt hat Niedersachsen somit bei 92 Prozent der Maßnahmen bereits mit der Umsetzung begonnen oder die Verfahren sogar schon abgeschlossen. Lediglich fünf Maßnahmen (8 Prozent) warten in Niedersachsen noch auf das Startsignal.
Frühzeitige Kommunikation zwischen allen an einem Planungsprozess Beteiligten, das Vermeiden von Doppelstrukturen und die Verkürzung von Bearbeitungsdauern und Fristen sind wichtige Schritte, die im Bundesrecht und auch in Niedersachsen bereits zu einem erheblichen Teil umgesetzt wurden.
Parallel dazu überprüft die Landesverwaltung ihre eigenen Aufgaben kritisch auf Vereinfachungs- und Beschleunigungspotentiale. Im Januar 2024 hat die Landesregierung den Startschuss für eine umfassende Vereinfachungsinitiative gegeben. Verfahren sollen in möglichst allen Bereichen der Landesverwaltung reduziert, effektiviert und beschleunigt werden. Teil dieser Initiative ist auch der bereits am 17. Oktober 2023 eingesetzte interministerielle Arbeitskreis zur Vereinfachung niedersächsischer Förderprogramme (IMAK) – ein Projekt des Koalitionsvertrages. Ziel des IMAK ist es, Empfehlungen zu erarbeiten, damit Förderprogramme einfacher, einheitlicher und digitaler werden. Damit will die Landesregierung die Kommunen, aber auch Vereine, Verbände und Wirtschaftsunternehmen von bürokratischem Aufwand entlasten.
Ministerpräsident Stephan Weil: „Wir setzen den Pakt für Beschleunigung in Niedersachsen konsequent um und verfolgen eine eigene Vereinfachungsinitiative. Die Landesregierung hat dabei mehrere Ziele: Es geht uns darum, das Land voranzubringen und dauerhaft gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für die hier lebenden Menschen zu sichern. Wir streben eine möglichst große Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft mit ,ihrer' Landesverwaltung an. Und schließlich: Die Verwaltung muss in Zeiten des demographischen Wandels auf Veränderungen eingestellt sein. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen auch in Zukunft ihre Aufgaben gut erledigen können.
Deswegen müssen wir uns als Land auch selbst fragen: Wie können wir einfacher werden, schneller und günstiger?“
Zum Erreichen dieser Ziele sollen möglichst viele Verwaltungsprozesse, Verfahren und Abläufe des Landes unter die Lupe genommen werden, um diese dann konsequent einfacher, schneller und günstiger zu gestalten. Das heißt weniger Personalaufwand, Reduzierung von Durchlaufzeiten und Prozessschritten und der Anzahl der Beteiligten.
Die Zusammenarbeit zwischen allen Prozessbeteiligten soll klar und möglichst sinnvoll aufeinander abgestimmt sein – es soll möglichst parallel statt nacheinander gearbeitet, Doppelungen sollen vermieden werden. Mithilfe von Digitalisierung, Automatisierung und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sollen Aufgaben leichter erledigt und das vorhandene Personal entlastet werden. Ergebnisse dieses Vereinfachungsprozesses sollen – wo immer das notwendig ist – durch gesetzliche Änderungen begleitet beziehungsweise ermöglicht werden.
Parallel arbeitet eine im März 2020 aufgebaute Clearingstelle als unabhängige Instanz bei der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN), die als Trägerin fungiert. Die Clearingstelle überprüft Gesetzes- und Verordnungsvorhaben bereits in ihrem Entstehungsprozess auf vermeidbaren bürokratischen Aufwand, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, und schlägt mögliche Alternativen vor. Zusätzlich zu den bisherigen Clearingverfahren, soll die Clearingstelle außerdem von nun an im Rahmen eines strukturierten Dialog-Prozesses der Landesregierung Vorschläge liefern, die Entlastungen für niedersächsische Unternehmen und Vereinfachungen in Verwaltungsabläufen bringen könnten.
Wirtschaftsminister Olaf Lies: „Einfacher, schneller und günstiger – die Clearingstelle ist ein wichtiger Baustein, denn gerade in Zeiten der Transformation und der multiplen Krisen ist es wichtig, Gesetze so zu gestalten, dass sie in der Praxis Prozesse vereinfachen. Mit der Clearingstelle haben wir hier ein Instrument, das nah dran ist an unseren Unternehmen.“
Hier einige Beispiele für bereits umgesetzte, für unmittelbar bevorstehende und für weitere geplante Vereinfachungen und Beschleunigungen:
Um den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu beschleunigen, wurden in Niedersachsen verschiedene gesetzliche Änderungen vorgenommen:
Mit dem Niedersächsischen Windgesetz (NWindG) wurden im April 2024 feste Flächenziele in den einzelnen Regionen für den Ausbau der Windenergie festgelegt. Landkreise, Städte und Regionen haben nun klare Vorgaben, die den Ausbau der Windenergie beschleunigen sollen. Das Niedersächsische Gesetz über die Beteiligung von Kommunen und Bevölkerung am wirtschaftlichen Überschuss von Windenergie- und Photovoltaikanlagen (NWindPVBetG) vom 18. April 2024 soll die regionale Akzeptanz steigern, indem Gemeinde und Bevölkerung direkt vom Betrieb der Anlagen profitieren. Kommunen werden zusätzlich motiviert, die geplanten Flächen schneller bereitzustellen.
Mit dem am 19. April 2024 in Kraft getretenen neuen Gesetz zur Steigerung des Ausbaus von Windenergieanlagen und Freiflächenanlagen (Windenergiebeschleunigungsgesetz) möchte Niedersachsen dazu die Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen.
Vereinfachend und beschleunigend wirken jetzt:
- Feste Fristen für Verfahrensschritte
- die Möglichkeit, auf Erörterungstermine zu verzichten, sowie die Nutzung von Video-, Telefon- oder Hybridkonferenzen.
- Verkürzung von Verfahren zur Flächenausweisung von mind. 2,2 Prozent der Landesfläche.
- Vereinfachung, Verkürzung und Digitalisierung von Fristen im niedersächsischen Raumordnungsgesetz
- Verzicht auf Raumordnungsverfahren für einzelne Windparks
- Verzicht auf eine erneute Umweltprüfung in den ausgewiesenen Wind-Beschleunigungsgebiete
- Ermöglichung von Teilplänen und Teilschritten Windenergie (Heranrobben) für die Träger der Regionalplanung (Änderung des NROG), statt immer das ganze RROP ändern zu müssen
- Unterstützung der Antragstellenden und der Landkreise bei der Nutzung des Antragstools ELiA (Elektronische immissionsschutzrechtliche Antragstellung) durch Bereitstellung des Antragstellungsprogramms ELiA und Schulungen
- Personalverstärkungsprogramm zur Unterstützung der Planungs- und Genehmigungsbehörden mit 30 neuen Vollzeitstellen
- Einrichtung und Aufbau der "Servicestelle Erneuerbare Energien" im MU: Beratungsdienstleistungen für Genehmigungs- und Planungsbehörden
Weitere Vereinfachungspotentiale bringen die jüngsten Änderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Die am 9. Juli 2024 in Kraft getretene Novelle des BImSchG setzt Möglichkeiten zur Beschleunigung von immissionsschutzrechtlichen Planungs- und Genehmigungsverfahren für Anlagen, die unter das Bundes-Immissionsschutzgesetz fallen (neben den Bereichen EE-Ausbau und Netzausbau auch Industrieanlagen) um.
Vielversprechend mit Blick auf eine Beschleunigung der Energiewende sind hier insbesondere die folgenden Änderungen:
- Der gänzliche Verzicht auf den Erörterungstermin bei der Errichtung oder Änderung von Windenergieanlagen an Land, Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien sowie Anlagen zur Speicherung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien,
- der Anspruch auf einen verbindlichen Vorbescheid der Genehmigungsbehörde für Windenergieanlagen zu einzelnen Fragestellungen, ohne dass der Antragsteller bereits Antragsunterlagen zu sämtlichen Genehmigungsvoraussetzungen erstellen muss (Wegfall der sogenannten positiven vorläufigen Gesamtbeurteilung),
- der Wegfall der Fristverlängerungsmöglichkeit für Stellungnahmen der zu beteiligenden Behörden bei Genehmigungsverfahren betreffend Anlagen zur Nutzung Erneuerbaren Energien oder Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien
- die Erweiterung des Anwendungsbereichs für Repowering von Windenergie-Altanlagen sowie
- der generelle Wegfall der aufschiebenden Wirkung bei der Einlegung von Rechtsmitteln gegen die Genehmigung der Errichtung und des Betriebs von Windenergieanlagen an Land.
Auch im Kultusbereich gibt es Prozesse, in denen unmittelbar Leistungen an Dritte gewährt werden. Hierzu gehören beispielsweise die Anerkennungen für ausländische Bildungsabschlüsse, die Bewerbungsverfahren für an einem Quereinstieg in den Schuldienst Interessierte, die Aufnahme in eine Schule, Schulwechsel, digitale Schulzeugnisse, Bewerbungsverfahren zum Vorbereitungsdienst und schließlich der Bereich finanzielle Förderungen für Träger im frühkindlichen Bereich.
Der Kultusbereich hat sich ambitionierte Ziele gesetzt:
Auf dem Weg in eine Bildungsverwaltung ohne zeitraubende Abläufe und Verfahren
- Daten sollen schnell zur Hand und ebenso schnell nutzbar sein für Entscheidungen auf Schulleitungsebene (Smarte Schulverwaltung / NEO-Niedersachsen).
- Sprachförderung muss schnell und bedarfsgerecht in der Schule ankommen – umständliches Antrags- und Prüfverfahren ist abgeschafft.
- „Kann ich das, will ich das?“ – Ein neues Tool soll Quereinsteigenden bei ihrer Entscheidung für den Lehrberuf helfen und somit auch Fehlentscheidungen fehlgeleitete Wege zu Lasten des Schulsystems verhindern helfen.
- Bereits umgesetzt: Sicheres und bezahlbares Mittagessen und warme Räume in Krisenzeiten – Millionensummen wurden im Zuge der Energiekrise direkt schlank und schnell an die Schulträger ausbezahlt - ohne langwierige Förderanträge.
- Fachkräfte-Mangel und Betreuungsnotstand in KiTas? – Änderungen im NKiTagG geben seit 1. August 2024 Trägern und Einrichtungen mehr Flexibilität bei der Kinderbetreuung und beim Einsatz von Erziehungskräften.
- Schülerfirmen gesichert – neue Umsatzsteuerpflicht – auch auf Intervention des Landes für Schulen vorerst verschoben.
- Neue Höchstgrenze bei Vergabeverfahren fast umgesetzt. Folge: Verwaltungsaufwand für Schulleitungen, Lehrkräfte und Schülerfirmen deutlich reduziert, Klassenfahrten gesichert.
- Geplant beziehungsweise in Arbeit: Schlanke Krankmeldung (im sehr personalintensiven Bildungsbereich essentiell): Meldung der Arbeits- beziehungsweise Dienstunfähigkeit des Personals an Schulen und Studienseminaren in digitaler Form über eine App.
- Schulen bekommen zukünftig mehr Spielräume und Freiheiten, um Unterricht und Schulleben nach ihren Bedarfen zu gestalten und alle Kinder und Jugendlichen bestmöglich auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen – Wege und Hürden für den eigenen Gestaltungsprozess sind und werden weiterhin freigeräumt – die Schulen können loslegen.
Kultusministerin Julia Willie Hamburg: „Der Bildungsapparat ist insgesamt mit seinen breit gefächerten Angeboten zur frühkindlichen und schulischen Bildung Dienstleister für sehr viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Gerade hier wollen und können wir den Erzieherinnen und Erziehern, Lehrkräften und weiteren Pädagogen mehr Zeit für die Kinder, Schülerinnen und Schüler und ihre pädagogischen Kernaufgaben verschaffen.
Die ersten umgesetzten Maßnahmen sind hier nur ein Einstieg.“
Einige Maßnahmen im Detail:
Mit der Entwicklung der Software „NEO Niedersachsen“ (im Projekt „Smarte Schulverwaltung Niedersachsen“ (SSVN)) arbeitet das MK an der Neu- und Weiterentwicklung der bisherigen Anwendungen der staatlichen Schulverwaltung. Ziel ist die Bereitstellung einer integrierten, webbasierten Lösung, die insbesondere die administrativen Tätigkeiten von der Stundenplan-Organisation bis zur Krankmeldung und Vertretungsregelung, die Schulstatistik, die Bedarfsplanung, die Durchführung der Ausbildung und der Staatsprüfung in den Studienseminaren, die Bewerbungs- und Einstellungsverfahren zum Vorbereitungsdienst sowie in den Schuldienst, die Versetzungsverfahren, Finanzhilfeberechnungen für Schulen in freier Trägerschaft sowie Aufgaben zum Arbeitsschutz und zum Gesundheitsmanagement unterstützt.
Unter anderem sollen mit dem Produkt NEO Niedersachsen erreicht werden:
- die Modernisierung und Erweiterung der bestehenden Verfahren,
- die Entlastung von Schulleitungen, Schulverwaltungskräften, Lehrkräfte
- und nichtlehrendem Personal an den Schulen,
- die Entlastung von Mitarbeitenden der Studienseminare, der Regionalen Landesämter für Schule und Bildung, des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung sowie des Niedersächsischen Kultusministeriums,
- die Gewährleistung von Nutzerfreundlichkeit, Informationssicherheit, Datenschutz, Barrierefreiheit,
- die attraktive Gestaltung der Bewerbungs- und Einstellungsverfahren,
- die Nutzung von Synergien zwischen bisher getrennten Fachanwendungen sowie
- die Verbesserung der Datenqualität inklusive Statistik.
Derzeit werden zwar bereits unterschiedliche Fachverfahren in erheblichem Umfang durch IT-Anwendungen unterstützt, diese sind aufgrund ihrer Genese jedoch weitgehend voneinander getrennt entwickelt worden und zwischenzeitlich veraltet.
Zum Ende des Schuljahres 2023/2024 konnte die erste, „Baby-NEO“ genannte Version der zukünftigen, landesweit einheitlichen Schulverwaltungssoftware „NEO Niedersachsen“ allen Schulleitungen bereitgestellt werden. Die Software wird im agilen Verfahren (weiter-) entwickelt. Aktuell besitzt sie nur wenige Funktionen – aber es ist der wichtige erste Schritt gemacht und die grundsätzliche Funktionsfähigkeit an sämtlichen Schulen kann in der Umgebung der jeweils vorhandenen Infrastruktur getestet werden.
Eine Möglichkeit zur Schulaufnahme an den Grundschulen soll als nächster Schritt relativ zeitnah freigeschaltet werden und wird mit einzelnen Schulträgern freiwillig pilotiert. Eine Information der Schulträger und eine Auswahl interessierter Pilotschulen wird kurzfristig gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden umgesetzt.
Die landesweite Bereitstellung eines einheitlichen Systems zur Schulaufnahme ist für das Folgejahr vorgesehen. In einem weiteren Schritt sollen dann die Vorgänge zur Bewerbung und Zulassung zum Vorbereitungsdienst mit Hilfe der neuen Software bearbeitet werden können.
Kultusministerin Julia Hamburg: „Mit NEO Niedersachsen stellt das Land die digitale Unterstützung der Schulverwaltung in weiten Teilen neu auf und entwickelt eine deutschlandweit einmalige, umfassende und zukunftsfähige Lösung. Niedersachsen kommt damit dem strategischen Anspruch nach, Prozesse zu vereinfachen, Synergien nutzbar zu machen, Schulleitungen und Lehrkräfte zu entlasten und Schnittstellen bereitzustellen, so dass auch Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte später profitieren. Von Anfang an ist die Einführung des Systems zudem darauf gerichtet, die Datenqualität, die zur Steuerung des Schulsystems unerlässlich ist, kontinuierlich weiter zu verbessern.“
Die zunehmende Heterogenität in unseren Bildungseinrichtungen, aber auch die Schnelllebigkeit der gesellschaftlichen Entwicklungen erfordert Unterrichtskonzepte, die die konkrete Situation vor Ort berücksichtigen und bedarfsgerechte Lösungen anbieten. Nicht jeder Weg, nicht jede Lösung ist für jede Schule gleichermaßen geeignet und zielführend. Schulen benötigen daher Spielräume und Freiheiten, um Unterricht und Schulleben nach ihren Bedarfen zu gestalten und alle Kinder und Jugendlichen bestmöglich auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen.
Der Leitgedanke des Freiräume-Prozesses ist es, zu ermöglichen statt zu verordnen. Schon heute gibt es viele Möglichkeiten für Schulen, Freiräume zu nutzen und viele Schulen – unter anderem auch angeregt durch das Projekt Zukunftsschule – haben sich auf den Weg gemacht, diese zu nutzen. Mit dem Freiräume-Prozess wollen wir sowohl Schulleitungen als auch Lehrkräften die bereits bestehenden Handlungsspielräume in der Schul- und Unterrichtsorganisation transparent machen und sie ermuntern, diese auch zur Gestaltung ihrer eigenen Schule zu nutzen. In der Handreichung „Schule gestalten – Freiräume nutzen“ sind die bestehenden Möglichkeiten in gebündelter Form zusammenfasst.
Im Schuljahr 2024/2025 wurde das Verfahren für zusätzliche Förderlehrkräfte bzw. Stunden für „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) optimiert und umgestellt. Mit dieser Regelung ist ein bisher aufwendiges, schriftliches Verfahren, bei dem umfangreiche Anträge ausgefüllt, eingereicht und geprüft werden mussten, obsolet. Das immer wieder erneute Einreichen und Prüfen des schuleigenen DaZ-Integrationskonzeptes der einzelnen Schule wird nicht mehr gefordert. Schulen erhalten jetzt im Rahmen eines Kontingents für Sprachförderung und Förderkonzepte zusätzliche Lehrkräfte-Soll-Stunden.
Diese zur Verfügung stehenden Sprachförderstunden werden und wurden jährlich bedarfsangepasst NEU auf die allgemeinbildenden Schulen verteilt. Die Verteilung der Sprachförderstunden erfolgt jetzt unter Nutzung der gemeldeten Daten der Schulen (Anzahl der Schülerinnen und Schüler nach Sprachniveau und Anzahl der Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Staatsangehörigkeit) und unter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Gesamtkontingents (aktuell 32.000 Lehrkräfte-Soll-Stunden).
Die von den Schulen gemeldeten Daten werden dabei je nach Intensität des Förderbedarfes basierend auf den unterschiedlichen Sprachniveaustufen faktorisiert.
Frühkindliche Bildung ist elementar und legt die Grundlagen für den weiteren Bildungsweg. Bundesweit besteht jedoch aktuell ein gravierender Fachkräftemangel. Um diesem – und den weiteren Problemen der Einrichtungsträger – begegnen zu können, hat das Land Änderungen im NKitaG umgesetzt, die den Trägern mehr Flexibilität geben. Mit einem Gesamtpaket werden der verantwortlichen kommunalen Jugendhilfe vor Ort sowie den Trägern zeitlich befristet mehr Möglichkeiten, Freiräume und Handlungsspielräume eingeräumt, um Verlässlichkeit und Planung auch in Zeiten des Fachkräftemangels bestmöglich zu gewährleisten.
Stehen auf dem Arbeitsmarkt nicht genügend pädagogische Fachkräfte zur Verfügung, so kann in einer Kindergartengruppe, einer Hortgruppe und einer altersstufenübergreifenden Gruppe bis zum Ablauf des 31.07.2030 anstelle der pädagogischen Fachkraft unter bestimmten Bedingungen eine pädagogische Assistenzkraft regelmäßig tätig sein. Voraussetzung ist, dass die Assistenzkraft eine hierfür entwickelte Weiterbildung aufnimmt.
- Bis zum Ablauf des 31. Juli 2026 wird die Betreuung in Randzeiten flexibilisiert, indem zwei pädagogische Assistenzkräfte eingesetzt werden dürfen, wenn auf dem Arbeitsmarkt nicht genügend pädagogische Fachkräfte zur Verfügung stehen. Diese Regelung unterstützt die Aufrechterhaltung des Betriebs und dient der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zudem ist es bis zum 31.07.2026 vor und nach den Kern- und Randzeiten ausreichend, wenn in einer Gruppe eine pädagogische Assistenzkraft und eine sonstige geeignete Person gleichzeitig anwesend sind. Voraussetzung ist, dass in der Kindertagesstätte eine weitere pädagogische Kraft bei Bedarf zur Verfügung steht. Diese Maßnahmen sollen Trägern die Flexibilität einräumen, verkürzte Öffnungszeiten zu vermeiden.
- Die Genehmigungspflicht für den Einsatz zweier pädagogischer Assistenzkräfte wird im Einzelfall durch eine Anzeigepflicht ersetzt. Hierdurch wird das Verfahren verschlankt und dadurch Verwaltungsaufwand in den Einrichtungen und beim Landesjugendamt reduziert.
- Die Möglichkeit, in unvorhersehbaren Fällen eine geeignete Vertretungsperson für bis zu drei Tage je Kalendermonat und Gruppe einzusetzen, wird befristet bis zum 31. Juli 2026 auf bis zu fünf Tage ausgeweitet. Damit wird eine flexible Reaktion auf personelle Engpässe ermöglicht und der kontinuierliche Betrieb der Einrichtungen gesichert. Ein Viertel aller Betreuungstage kann somit vertreten werden, bei einer viergruppigen Kita ermöglicht das, eine Kraft für Vertretungen vorzuhalten.
- Auch im Hinblick auf die Dritte Kraft wird auch hier dem Umstand des Fachkräftemangels Rechnung getragen, um eine pragmatische Organisation vor Ort zu ermöglichen. Stehen auf dem Arbeitsmarkt nicht genügend dritte Kräfte zur Verfügung, kann bis zum 31.07.2026 von der verpflichtenden dritten Kraft in Krippengruppen abgesehen werden, ohne dass die Gruppe geschlossen werden muss.
Ein wesentliches Projekt im Sinne im Rahmen von ‚Einfacher, schneller, günstiger‘ sind Erleichterungen bei Vergaben. Die Federführung liegt hier im Wirtschaftsministerium, es profitieren aber insbesondere auch Schulleitungen und Lehrkräfte.
Um die Vergabe von Aufträgen / Dienstleistungen an Dritte im Rahmen des genormten Vergabeverfahrens einfacher und schneller zu gestalten und unnötige Bürokratiehemmnisse abzubauen, werden in Kürze die Wertgrenzen im Unterschwellenbereich für alle Vergabeverfahrensarten angehoben werden. Liefer- und Dienstleistungen sollen dabei bis zu einem Auftragswert von 10.000 Euro (statt bislang 1.000 Euro) direkt, das heißt ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens, beauftragt werden können. Bei Bauleistungen soll dies bis zu einem Auftragswert von 15.000 Euro möglich sein. Die neuen Wertgrenzen werden es ermöglichen, kleinere Aufträge effizienter und mit weniger bürokratischem Aufwand zu vergeben.
Auslöser für diese bevorstehende Änderung war insbesondere ein neuer Bürokratismus und andere Schwierigkeiten bei der Organisation und „Vergabe“ von Klassenfahrten, Schulfahrten und anderen Schulaktionen Diese müssen nach neuem EU-Recht ausgeschrieben werden. Mit der Anhebung der Vergabegrenze, wird der Aufwand reduziert, da für Klassenfahrten zukünftig wieder der Weg der Direktvergabe möglich sein wird.
Die Anhebung der Wertgrenzen kommt aber nicht nur niedersächsischen öffentlichen Auftraggebern zugute, sondern auch den Unternehmen. Höhere Wertgrenzen können es KMU erleichtern, an der Erfüllung öffentliche Aufträge teilzunehmen, da sie weniger bürokratische Hürden überwinden müssen. Dies kann zu einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit und Innovation im Markt führen.
Darüber hinaus sollen auch weitere Schwellenwerte angehoben werden. So besteht die Absicht, im Dienstleistungsbereich die Grenzen auf 50.000 Euro bei Verhandlungsvergaben und 100.000 Euro bei beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb zu verdoppeln.
Im Baubereich möchte man freihändige Vergaben bis 200.000 Euro Gesamtauftragswert ermöglichen – bisher galt die 25.000 Euro-Schwelle als Einzelauftragswert. Für beschränkte Ausschreibungen soll die Grenze von bis zu 150.000 Euro gewerkabhängig auf generell zwei Millionen Euro angehoben werden.
Erforderlich ist für all das eine Änderung der Niedersächsischen Wertgrenzenverordnung (NWertVO), die alsbald vom MW im Einvernehmen mit MF und MI auf den Weg gebracht werden soll.
Durch diese Erleichterungen werden zunächst einmal die Vergabestellen des Landes und der Kommunen wie auch der Kammern erheblich entlastet. Die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich auf die größeren und anspruchsvolleren Vorhaben konzentrieren. Vereinfacht würden damit – wie gesagt – auch das Verfahren für kleine und mittlere Unternehmen, deren Aufwand minimiert wird und die sich dann auch um kleinere Aufträge bemühen können. Die geplanten Veränderungen in den Wertgrenzen führen aber insgesamt zu einer echten Entlastung für die Wirtschaft. Am Ende wird es für alle Beteiligten schneller gehen: für die Verwaltung, für die Unternehmen und letztendlich auch für die Bürgerinnen und Bürger. Ihnen kommt es im Endeffekt zugute, wenn beispielsweise das Ausbessern von Schlaglöchern schneller beauftragt werden kann oder wenn eine Schule schneller eine bessere Ausstattung erhält.
4. Vereinfachungsinitiative Niedersachsen am Beispiel Bauen
Bereits umgesetzt wurden in Niedersachsen im Baubereich verschiedene Maßnahmen, zur Verbesserung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. So wurden durch die Änderung der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) diverse Anforderungen, Prüfungen und Genehmigungserfordernisse abgeschafft bzw. reduziert.
Die in die NBauO eingebettete Umbauordnung ist in dieser Form ambitioniert und mit sehr weitgehenden, reduzierten Anforderungen einzigartig in Deutschland.
Bei der NBauO-Novelle sind zunächst Standards für Aufstockung, Umbau- und Ausbaumaßnahmen gesetzlich abgesenkt worden. Der Fokus soll künftig nur noch auf die grundlegenden Aspekte der Standsicherheit und des Brandschutzes gelegt werden. Die vereinfachten Regelungen für Bauteile gelten für alle Gebäudeklassen, ausgenommen sind Sonderbauten wie Schulen, Altenheime und Krankenhäuser.
Für Umbaumaßnahmen ist kein Genehmigungsverfahren mehr notwendig, ein Mitteilungsverfahren reicht aus.
Die Maßnahmen im Einzelnen:
- „Kernstück“ ist § 85 a NBauO („Umbaumaßnahmen und Nutzungsänderungen“) mit einer neuen Regelung zur wesentlichen Vereinfachung von Umbaumaßnahmen (z. B. Dachgeschossausbau, Aufstockung), die mit Hauptakteuren aus der Bauwirtschaft, der Architektenschaft, der LH Hannover und einem Brandschutzsachverständigen erarbeitet wurden. Außerdem ist eine Absenkung der bisher beim Umbau geltenden materiellen und formellen Standards auf ein niedrigeres, aber verantwortbares Niveau erfolgt.
- Für Nutzungsänderungen, Baumaßnahmen zur Modernisierung, zum Erhalt von Gebäuden und zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen sind Abweichungen unter bestimmten Voraussetzungen von den Bauaufsichtsbehörden zwingend zuzulassen, hier gibt es also kein Ermessen mehr.
- Die Erweiterung des Anwendungsbereichs verfahrensfreier Nutzungsänderungen hat das Ziel, die Zahl von genehmigungspflichtigen Nutzungsänderungen deutlich zu reduzieren.
Weitere Vereinfachungen für den Umbau im Bestand:
- Grundsätzliche Reduzierung der Grenzabstände (§ 5).
- Genehmigungsfreiheit für Dachgeschossausbau auch in Ortsteilen des § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich).
- Erweiterung des Entfalls der Pflicht Aufzüge nachzurüsten bei Aufstockungen um bis zu zwei Geschossen zu Wohnzwecken und für die nachträgliche Schaffung von Einstellplätzen auch auf Gebäuden, die zwischen 1993 und 2023 errichtet wurden.
- Entfall der Möglichkeit, bei bestehenden Gebäuden nachträglich die Errichtung von Kinderspielplätzen zu verlangen
- Erleichterung der Möglichkeit, den zweiten Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr zu führen.
(Unberührt bleiben die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes sowie weitere Regelungen zum Klimaschutz (z. B. PV-Pflicht nach § 32a NBauO).
Auch für Neubaumaßnahmen sind zahlreiche Neuerungen eingetreten. So wurde zum Beispiel die Pflicht zur Errichtung von Einstellplätzen für Kraftfahrzeuge Autos beim Wohnungsbau aufgehoben. Grenzabstände wurden verringert, so dass Grundstücke besser bebaubar sind. Mit einer Innovationsklausel sind Baumaßnahmen zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen erleichtert worden.
Mit der Novelle wurde auch der landesrechtliche Teil des Bund-Länder-Paktes für Beschleunigung umgesetzt. Baulücken können rascher genutzt, Dächer einfacher bebaut oder auch brachliegende Flächen in Wohnraum umgewandelt werden.
Die Maßnahmen im Einzelnen:
- Für den Wohnungsbau im vereinfachten Genehmigungsverfahren und für die genehmigungsbedürftige Errichtung oder Änderung von Mobilfunkanlagen ist befristet bis 2026 eine Genehmigungsfiktion von drei Monaten eingeführt worden. Das bedeutet, dass die beantragte Genehmigung als erteilt gilt, wenn die zuständige Behörde nicht innerhalb dieser Frist über den Antrag entscheidet. Voraussetzung für den Fristbeginn ist, dass der Antrag entscheidungsreif, also vollständig und mängelfrei ist.
- Grundsätzliche Reduzierung der Grenzabstände auch im Neubau
- Innovationsklausel in § 66 NBauO (z. B. für “Gebäudetyp E“) In Umsetzung des Bund-Länder-Paktes ist eine Bestimmung aufgenommen worden, dass Abweichungen von vorhandenen Regelungen zuzulassen sind „bei Baumaßnahmen zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen“. Abweichungen können nur noch dann abgelehnt werden, wenn sie grundlegenden Anforderungen zuwiderlaufen. Damit wird der Weg für innovative Bauprodukte und Häuser vom „Gebäudetyp E“ wesentlich vereinfacht.
- Künftig keine Pflicht mehr für Kfz-Einstellplätze im Wohnungsbau (§ 47 NBauO)
- Zur Reduzierung von Kosten für den Wohnungsbau ist entschieden worden, die Pflicht für KfZ-Einstellplätze für Wohnungen gänzlich zu streichen. Nach der im Gesetz enthaltenen Regelung können die Kommunen eine solche Pflicht bei der Errichtung von Wohngebäuden dann auch nicht mehr mit einer eigenen Satzung begründen.
- Erweiterung der Anerkennung von Typengenehmigungen (§ 73 a NBauO) Typengenehmigungen anderer Länder gelten nun auch in Niedersachsen uneingeschränkt
- Klarstellungen zur Genehmigungsfreiheit von temporären Nutzungsänderungen für Flüchtlingsunterkünfte (§ 61 NBauO).
Seit dem 01.01.2024 müssen Bauanträge in Niedersachsen grundsätzlich elektronisch eingereicht werden. Ausnahmen sind nur in besonderen Fällen möglich. Die meisten Bauaufsichtsbehörden haben bereits die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen. Dies reduziert die Notwendigkeit von Papierdokumenten und vereinfacht die Prozesse. Bei der Umstellung auf das elektronische System gibt es zwar noch vereinzelt Probleme, da viele Behörden gleichzeitig auf elektronische Kommunikation umstellen und die Software-Unternehmen die Schnittstellen anpassen müssen. Zudem möchten die Kommunen nicht nur die elektronische Übermittlung von Anträgen ermöglichen, sondern ihre eigene weitere Bearbeitung elektronisch vorantreiben. Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Ende des Jahres überall in Niedersachsen die elektronischen Dienste für das digitale Bauantragsverfahren zur Verfügung stehen.
Im Rahmen des ‚Einer für Alle‘-Konzeptes entwickelt ein Land oder eine Allianz aus mehreren Ländern eine Leistung zentral – für das Baugenehmigungsverfahren war dies das Land Mecklenburg-Vorpommern. Andere Länder und Kommunen können den Dienst dann mittels standardisierter Schnittstellen anbinden und somit mitnutzen. Niedersachsen hat bereits einige EfA-Dienste übernommen, die Anträge, Anzeigen und Mitteilungen im Baugenehmigungsverfahren elektronisch ermöglichen. Dazu gehören Anträge auf Baugenehmigungen, Abweichungen und Mitteilungen über genehmigungsfreie Baumaßnahmen.
Die Kommunen bekommen jedoch eine Übergangszeit, um diese Umstellung zu bewältigen.
Seit kurzem können auch qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker, Technikerinnen und Techniker sowie Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten Bauvorlagen einreichen, was den Genehmigungsprozess beschleunigt.
Bauminister Olaf Lies zeigt sich zufrieden: „Mit der Änderung der NBauO wird Bauen in Niedersachsen einfacher, schneller und günstiger. Wir setzen wichtige Impulse für die Bauwirtschaft. Ich hoffe sehr, dass jetzt schneller und unkomplizierter mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Gerade im Bereich Umbau ist Niedersachsen beispielgebend und legt hier einen ‚Niedersachsen-Standard‘. Und auch bei der Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren haben wir vieles umgesetzt, was zu einer Beschleunigung und Vereinfachung der Prozesse führt.“
Ziel des IMAK ist es, Handlungsempfehlungen für das Vereinfachen, Vereinheitlichen und Digitalisieren von Förderprogrammen zu entwickeln.
Das soll einerseits die Kommunen, andererseits aber auch Vereine, Verbände und Wirtschaftsunternehmen entlasten. Dabei werden insbesondere sowohl rechtliche Vereinfachungs- und Vereinheitlichungsmöglichkeiten von Förderverfahren als auch Möglichkeiten der Digitalisierung von Förderverfahren in den Blick genommen.
Unterhalb des IMAK wurden zwei Arbeitsgruppen eingerichtet. Eine erste Arbeitsgruppe soll die Bedingungen für kommunale Fördermittelempfänger deutlich erleichtern, die zweite soll Förderprogrammen für Vereine, Verbände und Wirtschaftsunternehmen vereinfachen. Die dabei am Ende im Ergebnis entstehenden Vorschläge aus den beiden Arbeitsgruppen sollen im IMAK diskutiert und der Landesregierung voraussichtlich im November 2024 vorgelegt werden.
Die Federführung für den gesamten IMAK und die Arbeitsgruppe 1 liegt im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI), für die Arbeitsgruppe 2 ist das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (MB) federführend.
Die ersten Schritte des IMAK dienten dazu, sich einen Überblick über die Förderprogramme des Landes mit einem (auch) kommunalen Empfängerkreis zu verschaffen und pauschale Zahlungsmöglichkeiten an kommunale Empfänger zu identifizieren. Geeignete Förderprogramme, die sich an kommunale Zuwendungsempfänger richten, sollen möglichst zeitnah in eine pauschalierte Förderung oder – analog der Kommunalinvestitionsförderprogramme (KIP 1 und KIP 2) – in eine budgetierte Form überführt werden.
Zeitnah soll jetzt in der Arbeitsgruppe 1 ein Gesetzentwurf für ein Niedersächsisches Kommunalfördergesetz erarbeitet werden. Damit sollen Förderungen abseits der §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung sowie der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften ermöglicht werden. Auf Basis dieses Gesetzentwurfs sollen mehrere Förderressorts Vorschläge für Fördermittel in vereinfachter Form, wie zum Beispiel über Budgetierung und Pauschalierung, an Mittelempfänger verteilen können.
Geplant sind zudem deutliche Vereinfachungen bei verbleibenden Zuwendungen, die sich an kommunale Mittelempfänger richten. Insbesondere Aspekte wie Finanzierungsart, Mittelbindung und Nachweis der Verwendung sollen vereinfacht werden. Auch die Digitalisierung von Förderverfahren sowie die Möglichkeit, Förderangebote des Landes zukünftig an einer zentralen Stelle im Internet auffinden und auch abwickeln zu können, werden derzeit intensiv im Rahmen des Vereinfachungsprozesses diskutiert.
Förderprozesse zu vereinfachen, um schneller und unkomplizierter Unterstützungen zu ermöglichen, ist auch das Ziel des Niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung in der Arbeitsgruppe 2. Hier werden Förderprogramme für Vereine, Verbände und Wirtschaftsunternehmen betrachtet. Einbezogen werden „Betroffene“ in Spitzenverbänden, Kommunen, Kammern, weiteren Verbänden und der Clearingstelle des Landes. Die Vereinfachungsideen umfassen den kompletten Förderzyklus, von der Vorantrags-Phase über die Projektdurchführung bis zur Projektabrechnung. Sie sollen Förderantragstellende und Verwaltungsmitarbeitende entlasten. Ziel ist es, bei der Mittelverwendung sowohl gegenüber den Ressorts als auch gegenüber den Begünstigten von einer Misstrauenskultur in eine Vertrauenskultur überzugehen. Der Schutz des Haushalts bleibt ein wichtiges Element. Zukünftig soll jedoch verhindert werden, dass in einigen Bereichen mehr Kosten durch das System entstehen als Nutzen für Zielerreichungen.
In Erwägung gezogen und ergebnisoffen diskutiert werden derzeit u.a. die folgenden Veränderungen:
- In Betracht käme die Einführung von Pauschalen und damit ein Abschied von Spitzabrechnungen mit hunderten Einzelbelegen. Aus der EU-Förderung gibt es gute Erfahrungen, mit dem Nachweis des mit einer Förderung erzielten Nutzens.
- Zuwendungen für Projekte mit einem noch zu bestimmenden Schwellenwert könnten zukünftig auf Grundlage eines Ausgaben- und Finanzierungsplans als Pauschalbetrag gewährt werden. Die Auszahlung der Zuwendung und die Verwendungsnachweisprüfung würden sich dann zukünftig nur noch auf das Erreichen inhaltlicher Meilensteine sowie abschließend des Zuwendungszwecks beschränken.
- Im Sinne eines Abschieds von der Misstrauenskultur wird erwogen stichprobenbasierte Prüfungen anstelle Vollprüfungen aller Projekte und aller Unterlagen durchzuführen. Entsprechend einer vorzunehmenden Risikoeinschätzung würde dann nicht mehr jeder Verwendungsnachweis von der Bewilligungsbehörde geprüft. Gerade bei kleinen Projekten, Projekten mit wenigen einfachen einzuhaltenden Fördervoraussetzungen oder auch bei Bewilligungen an erfahrene Projektträger könnte sich eine stichprobenbasierte Prüfung anbieten.
Die Ämter für regionale Landesentwicklung (ÄrL) wollen zudem ein medienbruchfreies Online-Antragsmanagement einführen. Dies erleichtert dann für die Antragstellenden, aber auch für die Behördenmitarbeitenden die Abläufe und verkürzt Bearbeitungszeiten. Erste Tests laufen.
 Bildrechte: Niedersächsische Staatskanzlei
Bildrechte: Niedersächsische Staatskanzlei
Artikel-Informationen
erstellt am:
20.08.2024
Ansprechpartner/in:
Pressestelle der Niedersächsischen Landesregierung
Nds. Staatskanzlei
Planckstraße 2
30169 Hannover
Tel: 0511/120-6946
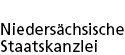
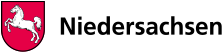

 English
English