Europaministerkonferenz
Aufgaben der Europaministerkonferenz
Bereits seit 1992 ist die Europaministerkonferenz (EMK) die Fachkonferenz der für Europafragen zuständigen Europaministerinnen und -minister, Senatorinnen und Senatoren der 16 deutschen Länder. Mit ihrer Gründung wurde dem Anliegen der Länder nach aktiver Teilhabe am europäischen Integrationsprozess Rechnung getragen. Ihre wesentlichen Aufgaben sind die Interessenvertretung der Länder in Europaangelegenheiten gegenüber dem Bund und der EU, sowie die Abstimmung der europapolitischen Aktivitäten der Länder und die Koordinierung ihrer Informationspolitik zur Förderung des europäischen Gedankens.
In Niedersachsen wird die Funktion der Europaministerin durch Melanie Walter, Ministerin für Europa und Regionale Landesentwicklung, wahrgenommen.
Der Vorsitz der EMK wechselt jährlich in alphabetischer Reihenfolge zwischen den 16 Ländern. Niedersachsen hatte den Vorsitz vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018. Pro Jahr finden bis zu drei Konferenzen auf politischer Ebene statt. Zu den Konferenzen werden auch Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung eingeladen sowie regelmäßig hochrangige externe Gäste als Referentinnen und Referenten und Diskussionspartnerinnen und -partner.
Die Beschlüsse der EMK bilden häufig die Grundlage entsprechender Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) der Länder oder des Bundesrates. Sie werden auf Arbeitsebene durch die Ständige Arbeitsgruppe der EMK (StAG) vorbereitet, in der das Land Niedersachsen durch das Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung vertreten ist.
Informationen zum aktuellen Vorsitz der EMK können unter www.europaminister.de abgerufen werden.
Rechtsgrundlagen der Europaministerkonferenz
Die Länder gründeten am 1. Oktober 1992 die Europaministerkonferenz (EMK). Diese ersetzte die 1990 von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) geschaffene „Europa-Kommission“, deren Aufgabe es war, die Länderinteressen im europäischen Integrationsprozess zu wahren und Beschlüsse der MPK vorzubereiten.
Die Bund-Länder-Zusammenarbeit wurde nach dem Vertrag von Maastricht über die Europäische Union 1992 neu gestaltet. Der so genannte „Europa-Artikel“, Artikel 23 Grundgesetz (GG) regelte dies: Nach ihm sind die deutschen Länder in EU-Angelegenheiten an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen. Mitwirkungsrechte stehen den Bundesländern auch bei Änderungen der vertraglichen Grundlage der EU, der Erarbeitung und Verabschiedung von europäischen Rechtsakten und bei der Wahrung des Subsidiaritätsprinzips zu.
Verschiedene Gesetze und Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern konkretisieren diese Rechtsgrundlage: So gibt es Unterrichtungspflichten der Bundesregierung, das Recht des Bundesrats auf Stellungnahme zu EU-Vorhaben sowie Abstimmungsverfahren zwischen Bund und Ländern, in denen Verhandlungspositionen gegenüber den europäischen Institutionen festgelegt werden. Ferner regeln eine Bund-Länder-Vereinbarung sowie das Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBLG) die Befugnisse der Länder.
Das Integrationsverantwortungsgesetz (IntVG) verdeutlicht die Beteiligung und Zustimmungspflicht von Bundestag und Bundesrat bezüglich vereinfachter Änderungen von EU-Verträgen. Hier ist u.a. das einfache Vertragsänderungsverfahren (Art. 48 Abs. 6 des Vertrages über die Europäische Union (EUV)) und die allgemeine Brückenklausel zur Änderung des Gesetzgebungsverfahrens in einem festgelegten Politikbereich (Art. 48 Abs. 7 EUV) genannt.
Das Bundesverfassungsgericht hat festgelegt, dass durch ein solches Verfahren bewirkte vertragliche Änderungen der Zustimmung von Bundestag und, abhängig vom Politikbereich, auch von Bundesrat bedürfen.
Weitere Informationen zu den Rechtsgrundlagen:
- Beschlüsse der 1. Europaministerkonferenz
Beschluss zur Konstituierung der Europaministerkonferenz in Wildbad Kreuth vom 1./2. Oktober 1992
- Bund-Länder-Vereinbarung zum europäischen Stabilisierungsmechanismus
Das Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen des europäischen Stabilitätsmechanismus sieht vor, dass die Bundesregierung den Bundesrat schriftlich unterrichtet. Diese Vereinbarung zwischen Bund und Ländern regelt die Einzelheiten der Unterrichtung.
Ansprechpartner für die Europaministerkonferenz
Thorsten Schumacher
Telefon: +49 (0) 511-120-8449
E-Mail: thorsten.schumacher@mb.niedersachsen.de
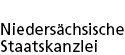
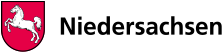

 English
English